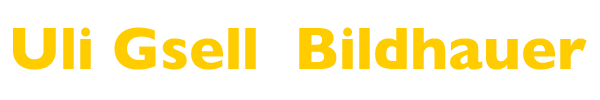Kunst und Natur – „komplexe Reaktion eines Augenblicks“
Kunst und Natur – das sind zunächst einmal zwei Pole, die sich in der gesamten Kulturgeschichte der Menschheit gegenüberstehen. Natur ist der Gegenbegriff zu Kunst, denn zur Kunst wird erklärt, was gerade nicht natürlichen, sondern was geistigen Ursprungs ist. Goethes in diesem Zusammenhang immer wieder zitierter Vers: „Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen / und haben sich, eh man es denkt, gefunden“ ist mir daher – ich geb’ es zu – in seiner letzten Konsequenz immer rätselhaft geblieben. Ist es wirklich so, dass Kunst und Natur sich – eh man es denkt – finden?
Wenn man den Arbeiten von Uli Gsell begegnet, diesen steinernen Skulpturen, in weiten Teilen roh und unbearbeitet, im Detail aber subtil markiert, dann landet man unweigerlich bei dieser Frage. In seinem Werk prallen die Gegensätze aufeinander – nicht offensiv, nicht aggressiv, sondern leise, aber deutlich: natürliche Ausdrucksform und künstlerischer Eingriff, unbehandeltes Material und bearbeitete Fläche.
Dabei ist der kunsthistorische Hintergrund, vor dem sich dies abspielt, einigermaßen klar abzustecken. Die Natur ist über die Jahrhunderte hinweg eines der großen Themen der Kunst. Früh wird sie zum Motiv, später dann, im 20. Jahrhundert, zum Material der Kunst. Sie ist im einen Fall stilles Gegenüber, im anderen geforderter Dialogpartner. Dabei spielt hier zunächst einmal keine Rolle, ob die Landschaft – beispielsweise – den Weg ins Bild findet, also abgemalt, abgezeichnet oder abfotografiert wird, realistisch oder verfremdet. Oder ob die Natur offener Raum bleibt, in dem die Künstler direkt agieren, indem sie Orte verwandeln, verformen, besetzen beziehungsweise ob die Künstler Natur als Material in den Atelier- und Ausstellungsraum holen und dort als Fragmente der Welt draußen bearbeiten.
Natur ist in beiden Fällen das andere, das sich von uns rational handelnden Menschen unterscheidet, nicht eins mit uns ist, mit dem wir uns aber, auch dies eine uralte Sehnsucht, in paradiesischer Eintracht verbinden wollen und doch kaum können – in der christlichen Vorstellungswelt steht schon ganz am Beginn aller Zeiten der Sündenfall jeder idyllischen Erfüllung im Wege. Es ist wohl bezeichnend, dass unser historisches Bewusstsein, wie Gottfried Boehm einmal schrieb, die Naturgeschichte quasi ausschließt. Sie ist uns nicht präsent, obwohl doch so existenziell mit der Geschichte des Menschen verbunden. Die Etappen, in denen wir Zeitabläufe gliedern, sind nicht Etappen von Stein- und Erdschichten, Baumringen, Meerestiefen und Gletschergrößen. Es sind Etappen der Kriegserklärungen und Friedensverträge, der Herrscher und Revolutionäre, der Erfindungen und der Moden – Etappen der Geistesgeschichte und kultureller Entwicklungen. Und so wird die Natur – unbeherrschbar, unbezwingbar, fremd – zur zentralen Herausforderung des denkenden und gestaltenden Menschen.
Der japanische Bildhauer Isamu Noguchi, der wie Uli Gsell mit rohen Steinblöcken arbeitet, hat den künstlerischen Prozess in seinem Werk als einen Dialog zwischen sich selbst und der „Urmaterie des Universums“ beschrieben. In gewissem Sinne könnte das – wie wir sehen werden – auch für Uli Gsell gelten. Denn im Stein selbst, wie er ihn verwendet, begegnen wir nicht nur einem Stück Naturwirklichkeit im Kunstkontext, sondern auch einem Zeugnis von „Urmaterie“, also von Geschichte. Und der künstlerische Eingriff ist nicht nur Auseinandersetzung und Kommentar, sondern auch Ausdruck eines aktuellen zeitlichen Moments. Bei allen Veränderungen im Werk von Uli Gsell ist diese Polarität bis heute das beständige, die Skulpturen verbindende Element.
Die erste bildhauerische Arbeit von Uli Gsell entstand, als sich der 1967 in Stuttgart geborene Künstler um die Aufnahme an der Akademie bewarb. Eigentlich wollte er in die Klasse von Herbert Baumann – und das wäre wohl genau sein Platz gewesen -, doch Baumann war damals schon krank, und so studierte Uli Gsell schließlich bei K-H. Seemann, Robert Schad, Josef Nadj und zuletzt bei Micha Ullman. Vor allem die letzten beiden haben – so würde ich sagen – Eindrücke bei ihm hinterlassen. Entscheidender für die Entwicklung der eigenen Sprache waren aber möglicherweise Reisen nach Südamerika und ein Studienaufenthalt in Mexiko.
Eine der frühesten Arbeiten, die ich von Uli Gsell kenne, stammt von 1993 und heißt „Zahn zu Zahn“. Ich bin ihr erst später begegnet, als sie Ende der 90er Jahre im Rahmen des Skulpturenwegs „Der große Alb-Gang“ präsentiert wurde. Schon in dieser Skulptur aus dem letzten Studienjahr wird die typische Handschrift Gsells deutlich: In dem zwei Meter hohen, vierkantigen, stelenartigen, grauen Granitblock, der aus der Ferne zunächst wie ein geschlossener Körper wirkt, hat der Künstler die Masse des Steins mittels Spaltungen, Bohrungen, eingeschnittenen Linien und Flächen aufgebrochen, ist quasi ins Innere des Steins eingedrungen, hat dabei seine Spuren hinterlassen, kontrollierte Abdrücke eines Forschers in der Natur. Und diese Spuren sind es nun, denen unser Blick folgt, über die er die Oberfläche des Steins erkundet, an deren Kanten er abbricht, deren Stegen er nachspürt, in dessen Löcher er fällt. Das Sehen selbst wird zu einem haptischem Prozess – so widersprüchlich das klingt –, die visuelle wird zu einer körperlichen Erfahrung, der schließlich, wenn möglich, die Hand folgt, in dem sie streicht, streichelt, Steinoberfläche auf Hautoberfläche wahrnimmt.
Es war bisher immer wieder von der Sensibilität die Rede, mit der Uli Gsell den Findling bearbeitet und ihm Formen sozusagen einschreibt. Dabei darf aber eines nicht außer Acht gelassen werden: Uli Gsell greift zugleich rigoros und entscheidend in die natürlich Form des Materials ein. Vor allem die Spaltungen sind ein rigides, kraftvolles Mittel der künstlerischen Aktion. Die Einheit des Steins wird zerstört, die geschlossene Behauptung des natürlichen So-Seins wird zur Frage nach dem Wie-Sein umformuliert.
Ulrich Rückriem, einer der großen zeitgenössischen Bildhauer und in mancher Hinsicht sicher ein „Vorbild“ für Gsells künstlerischen Weg, der selbstverständlich neue, eigene Akzente setzt, Ulrich Rückriem also wurde einmal als „der Materialist und der zeichnend in das Volumen des Steins und des Raums vordringende Idealist“ bezeichnet. In seinen Arbeiten, so hieß es an gleicher Stelle, treffe man auf die Dialektik der gestaltbestimmenden Teilung und der natürlichen Ausdruckform des Steins. Beide Bemerkungen beschreiben sehr gut auch Kennzeichen von Uli Gsells Arbeit.
Dass Uli Gsell die Steine, die er in einem Steinbruch in der Nähe von Koblenz findet, lange in seinem Atelier liegen lässt, immer wieder betrachtet, aufstellt, hinlegt, verschiebt und in Zeichnungen – zum Teil auf dem Stein selbst – Strukturen der „künstlerischen Erschließung“ erprobt, scheint vor diesem Hintergrund ganz eindeutig zu sein. Denn seine bildhauerische Arbeit zeugt schließlich von großer Sicherheit und Souveränität im Umgang mit dem Material. Jede Spaltung, jeder Bruch führt zu einer neuen Form, bedingt den nächsten Schritt, der Arbeitsprozess ist langwierig und überlegt. Auf meine Frage, wann denn eine Skulptur für ihn beendet sei, sagt Uli Gsell: „Wenn eine bestimmte Stimmung ausgedrückt ist, wenn die Form klingt.“
Das Auge des Künstlers ist dafür der beste Maßstab. Der bereits vorhin zitierte Isamu Noguchi hat zu seiner Arbeit gesagt: „Jede Skulptur stammt aus einer komplexen Reaktion eines Augenblicks, der nicht reproduzierbar ist.“ Dieser Moment trifft auf die Dauer, die dem Material innewohnt. Hier hat sich nichts „eh man es denkt“ gefunden. Es ist der bewusst komponierte Akkord zwischen Ewigkeit und Augenblick, der in den Skulpturen von Uli Gsell schwingt und den starren Stein in Bewegung versetzt.